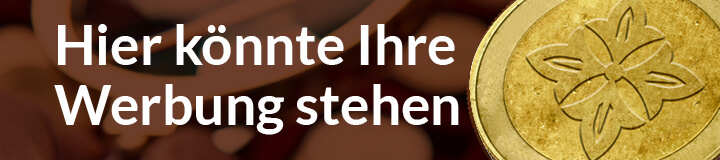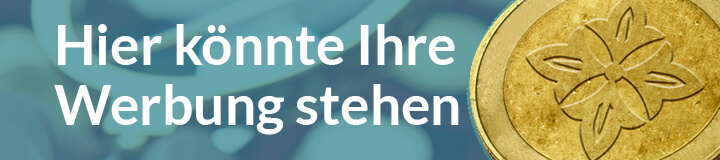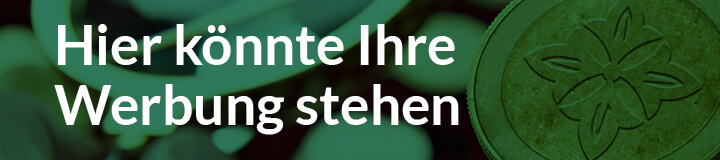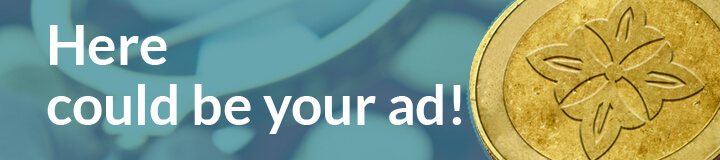Der „Erfurter Schatz“ in der Alten Synagoge
Wenn es kein Logo gibt, wird diese Spalte einfach leer gelassen. Das Bild oben bitte löschen.
(Dieser Text wird nicht dargestellt.)
Museum Alte Synagoge Erfurt
Waagegasse 8,
99084 Erfurt
Telefon: 0(49) 361 655 1520
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10:00 – 18:00 h (am ersten Dienstag im Monat Eintritt frei)
Siehe auch Museum digital Thüringen.
„Die Alte Synagoge ist mit ihren ältesten Bauteilen aus dem 11. Jahrhundert die älteste, bis zum Dach erhaltene Synagoge in Mitteleuropa. Hier ist 2009 ein außergewöhnliches Museum entstanden und ein Ort geschaffen worden, an dem mittelalterliche Sachzeugnisse der jüdischen Gemeinde Erfurts der Öffentlichkeit zugänglich sind. Zusammen mit der Dokumentation der Baugeschichte der Synagoge selbst sollen sie ein Schlaglicht auf die Geschichte der Erfurter Gemeinde werfen, die im Mittelalter eine herausragende Stellung in Europa innehatte.
Die Ausstellung der Alten Synagoge veranschaulicht die Geschichte der ersten jüdischen Gemeinde Erfurts. Im Hof sind Grabsteine des zerstörten mittelalterlichen Friedhofs zu sehen. Die Baugeschichte der Synagoge ist Thema im Erdgeschoss. Der Keller beherbergt den in der Nähe der Synagoge gefundenen Schatz, den ein Jude während des Pogroms von 1349 vergrub. Die Erfurter Hebräischen Handschriften werden im Obergeschoss thematisiert.“ (Quelle: Jüdisches Leben Erfurt).
Zum Erfurter Schatz heißt es im Internetauftritt der Geschichtsmuseen der Stadt Erfurt:
„Im Keller der Alten Synagoge wird der sogenannte Erfurter Schatz ausgestellt, der höchstwahrscheinlich während des Pogroms von 1349 vergraben wurde – ein in Umfang und Zusammensetzung einmaliger Fund. Er wurde 1998 kurz vor dem Abschluss archäologischer Untersuchungen auf dem Grundstück Michaelisstraße 43 unweit der Alten Synagoge unter der Mauer eines Kellerzugangs entdeckt.
Der Schatz hat ein Gesamtgewicht von fast 30 Kilogramm. Mit etwa 24 Kilogramm machen 3.141 Silbermünzen sowie 14 silberne Barren verschiedener Größen und Gewichte quantitativ den größten Anteil aus. Außerdem enthielt der Fund mehr als 700 Einzelstücke gotischer Goldschmiedekunst in teilweise exzellenter Ausführung.
Dabei handelt es sich um ein Ensemble an Silbergeschirr, bestehend aus einem Satz von acht Bechern, einer Kanne, einer Trinkschale sowie einem Doppelkopf. An Schmuckstücken sind besonders acht Broschen verschiedener Größe und Form mit zum Teil üppigem Steinbesatz hervorzuheben sowie acht Ringe aus Gold und Silber. Kleinere Objekte wie Gürtelteile und Gewandbesatz machen den zahlenmäßig größten Anteil der Goldschmiedearbeiten aus.
Das bedeutendste Objekt im Schatz ist ein jüdischer Hochzeitsring aus dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts. Er besticht vor allem durch die herausragende handwerkliche Qualität, in der die gotische Miniaturarchitektur aus reinem Gold gearbeitet ist.
Im Vergleich mit anderen Arbeiten der Goldschmiedekunst und vergleichbarer Handwerkszweige sowie unter Einbeziehung zeitgenössischer Abbildungen können die Goldschmiedearbeiten im Erfurter Schatz ins ausgehende 13. Jahrhundert und die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden.
Obgleich die Gotik eine besonders schmuckfreudige Epoche war, in der Männer und Frauen ihren Wohlstand gerne mit zahlreichen Schmuckstücken zeigten, und auch Silbergeschirr keine Seltenheit war, haben sich profane Goldschmiedearbeiten kaum erhalten. Man beurteilte sie vor allem nach dem Materialwert, sie stellten neben ihrer eigentlichen Funktion auch eine Wertanlage dar. Daher wurden sie bei Bedarf versetzt, verkauft oder eingeschmolzen. Zusätzlich führten schnell wechselnde Moden dazu, dass „altmodische” Gegenstände zu neuen, moderneren Schmuckstücken umgearbeitet wurden.
Entsprechend einmalig ist der Erfurter Schatzfund, der bereits in Paris, New York und London ausgestellt war und seit 2009 dauerhaft in der Alten Synagoge zu sehen ist.“ (Quelle: Jüdisches Leben Erfurt)
Und im Deutschlandfunk hieß es am 24.Mai 2007 anlässlich der Präsentation des Fundes in Paris:
„In dem mottenzerfressenen Tuch, das in Erfurt unter der Kellertreppe entdeckt wurde, lagen auch dreitausend französische Silber-Münzen und mehrere Silber-Barren. Mit diesem Kapital zählte der jüdische Besitzer mindestens zur oberen Mittelschicht der Stadt. Die Forscher meinen, dass es sich um das Betriebsvermögen eines erfolgreichen Fernhandelskaufmanns handelt – auf dem Fernhandel beruhte im Mittelalter Erfurts Wohlstand. Man kann vermuten, dass nicht der gesamte Schatz Familienbesitz war. Ein Teil der kostbaren Stücke, die so liebevoll im Geschmack der Zeit gestaltet waren, sollte vielleicht verkauft werden.“ (Quelle: Deutschlandfunk)
Textzusammenstellung und Fotos: Sturm, Erfurter Münzfreunde e.V.